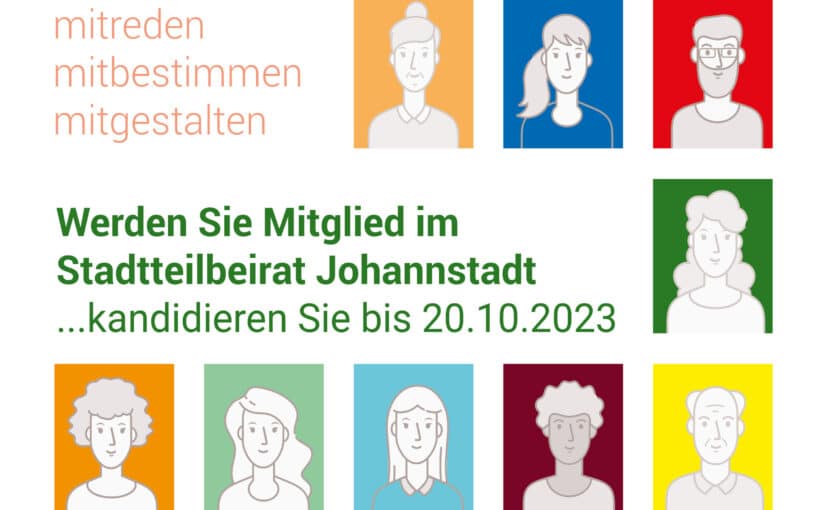Demokratie lebt vom Mitmachen und das ist am einfachsten vor der eigenen Haustür. Darum gibt es neben dem Bundestag, dem Landtag, dem Stadtrat und den Stadtbezirksbeiräten seit 2019 den Stadtteilbeirat Johannstadt. Das lokale Gremium wird alle zwei Jahre neu zusammengesetzt, das nächste Mal am 4.11.2023. Kandidaturen können bis 20.10.2023 beim Stadtteilverein eingereicht werden. Wahlen in der Johannstadt: Jetzt für den neuen Stadtteilbeirat kandidieren weiterlesen
Schlagwort: Johannstadt
5 vor 12: KrankenAUS? NEIN DANKE!
Mit einem lautstarken Trillerpfeifen-Einsatz untermauerte die Belegschaft vom St. Joseph-Stift Dresden letzte Woche ihre Forderung nach einem sofortigen Inflationsausgleich.
Güntzplatz: Straßenbahnlinien 6 und 13 werden Freitag bis Sonntag umgeleitet
Wegen dringend notwendiger Instandsetzungsarbeiten am Güntzplatz vom Freitag, 15. September, 4:10 Uhr bis Montagfrüh, 18. September, 4 Uhr müssen die Straßenbahnlinien 6 und 13 am kommenden Wochenende wie folgt umgeleitet werden:
- Linie 6 wird in zwei Äste geteilt: Im Osten Dresdens ist sie nur zwischen dem Endpunkt Niedersedlitz und dem Güntzplatz unterwegs, dort wird sie zur Linie 13 und fährt nach Prohlis. Im westlichen Abschnitt verkehrt sie nur zwischen Wölfnitz und Albertplatz und wendet als Einsatzwagen in der Innenstadt.
- Linie 13 wird ebenfalls geteilt und fährt von Prohlis kommend nur bis zur Dürerstraße. Von dort wird sie zur Linie 6 in Richtung Niedersedlitz. Im nordwestlichen Abschnitt verkehrt sie nur zwischen Kaditz und Rosa-Luxemburg-Platz. Wegen zusätzlicher Baumaßnahmen an der Kreuzung Bautzner / Rothenburger Straße endet sie am Freitag, dem 15. September, bis etwa 15 Uhr bereits an der Haltestelle Görlitzer Straße.
- Für beide Linien wird zwischen Albertplatz und Permoserstraße ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.
- Der Autoverkehr ist nur marginal betroffen und wird im Wesentlichen an der Baustelle vorbeigeführt. Lediglich die Linksabbieger aus der Sachsenallee in Richtung Gerokstraße müssen eine kleine Umleitung über die Dürerstraße in Kauf nehmen.
Hintergrund der Umleitungen ist eine dringend notwendige Gleisreparatur am Abzweig Sachsenallee. Hier müssen Weichenzungen erneuert und das Gleis wegen Lageschäden durchgearbeitet werden. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 40.000 Euro und werden aus dem Budget für die laufende Instandhaltung der Infrastruktur bezahlt.
Quelle: Dresdner Verkehrsbetriebe AG
In eigener Sache: Dieser Artikel wurde verfasst/redaktionell bearbeitet durch die ehrenamtliche Stadtteilredaktion von johannstadt.de & die ZEILE. Sie haben auch Lust über die Johannstadt zu schreiben, Beiträge zu lektorieren oder die Redaktion organisatorisch zu unterstützen? Dann melden Sie sich unter redaktion@johannstadt.de.
Unterstützen können Sie unsere Arbeit auch mit Ihrer Spende! IBAN: DE65 4306 0967 1215 9641 00, GLS-Bank Bochum oder über johannstadt.de.
Epochenwechsel für die ZEILE: Ausgabe 7 erscheint vorzeitig im September
Ausgabe 7 des Johannstädter Stadteilmagazins ZEILE ist am 1. September 2023 erschienen. Sie wurde erstmalig zum Auftakt der bunten Karawane im Projekt PLATTENWECHSEL unterwegs im Stadtteil von Hand zu Hand verteilt. Jetzt ist sie für alle Interessierten wieder kostenfrei in Läden und Geschäften sowie an den bekannten Stellen erhältlich.
Es ist die vorerst letzte ZEILE, die in diesem gewohnten Rahmen gedruckt werden kann, da die Fördergelder Ende des Monats auslaufen.
Wendepunkt für das kostenfreie Stadtteilmagazin
Die ZEILE ist mit dieser siebten Ausgabe an einem Wendepunkt angekommen: Die Projektförderung läuft aus und damit auch die weitere Garantie auf ein kostenfreies Stadtteilmagazin der Johannstadt in hochwertigem Format. Wie es mit der ZEILE weitergeht, hängt nun nicht zuletzt von Rückmeldungen aus der Bewohnerschaft ab: Wie sehr liegt ihnen die ZEILE am Herzen?
Die Frage drängt: Soll es weiterhin ein eigenes, (mikro)lokales Magazin in der Johannstadt geben, das die Geschichte(n) des Stadtteils weitererzählt? /// Das in den gelebten Alltag schaut und Orte und Menschen vorstellt, die die Johannstadt zu dem machen, was sie ist? /// Ein Magazin, das gut vernetzt ist und aus Einrichtungen und städtischen Gremien aktuell berichtet? /// Das bürgernah informiert, was auf Ebene der Landeshauptstadt in der Johannstadt geplant wird? /// Das Stimmen vor Ort einfängt und die Menschen, die hier leben, selbst zu Wort kommen lässt?!
Auf die Rückmeldungen der Johannstädter und Johannstädterinnen kommt es nun an. Die Redaktion hofft auf das Echo aus dem Stadtteil.

Anlässlich der umfänglichen Abschlussveranstaltung zum Förderprojekt PLATTENWECHSEL. Wir in Aktion am Johannstädter Kulturtreff ging die ZEILE diesmal ausserplanmäßig bereits im August in den Druck.
Die Sonderausgabe ist eine künstlerische Dokumentation und befasst sich mit den erreichten Ergebnissen soziokultureller Arbeit in der Johannstadt im Rahmen von vier Jahren Förderung durch das bundesweite Projekt UTOPOLIS.
Eine entsprechende Ausstellung läuft derzeit im Stadtteilladen.
Die ZEILE ist eines der geförderten Teilprojekte unter dem Dach des UTOPOLIS-Projektes PLATTENWECHSEL. Das Printmagazin ZEILE veröffentlicht zusätzlich zum online-Magazin johannstadt.de zweimal jährlich von Bewohner*innen selber geschriebene, erlebte oder recherchierte Beiträge aus dem Stadtteilleben. Das macht die ZEILE authentisch und zum beliebten Sprachrohr für die alte und die junge Johannstadt. An Inhalten für die neue Ausgabe mangelt es nicht, Mitschreibende sind in der Redaktion jederzeit willkommen – doch Druck und Layout fallen nun in die Finanzierungslücke.
/// Ein ZEILE-Ratschlag findet statt für alle, die Interesse am Stadtteilmagazin haben: am 18.Oktober ’23 um 18 Uhr im Stadtteilladen, Pfotenhauerstraße 66. ///
Auf den Rückhalt kommt es an
Es kommt auch auf den Rückhalt im Stadtteil an, ob die ZEILE weiter Bestand hat. Die nächste Ausgabe ist frühestens im Frühjahr 2024 zu erwarten. Ob es dazu kommen kann, ist noch völlig offen. Unterstützung jeglicher Art ist willkommen – schreibend, bebildernd, erzählend, organisatorisch, bei der Verteilung und nicht zuletzt finanziell: Wer kann, gibt seinen Teil, um der Johannstadt ihr Pionier-Projekt eines eigenen Stadtteilmagazins, online und gedruckt, zu erhalten.
Bis dahin gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Zukunft der ZEILE mitzugestalten:
- Aktuelle, sowie (noch) alle ältere Ausgaben und Kontakt zur Redaktion:
>im ZEILE Büro im Johannstädter Kulturtreff Elisenstr. 35 donnerstags von 15 bis 17 Uhr
> im Stadtteilladen, Pfotenhauer Str. 66 mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr im Rahmen der dort gezeigten Ausstellung zum PLATTENWECHSEL.Mitarbeitende stehen für Rückmeldungen, Fragen und Gespräch bereit. Ausserdem dürfen gerne Spenden in die Box gebracht werden. - Über johannstadt.de können über den formatierten Spenden-Button auf dieser Seite Spenden mit Verwendungszweck “ZEILE” zur weiteren Planung und Sicherung der nächsten Ausgabe überwiesen werden.
- Wir würden uns freuen über Nachricht und Anregungen von Leser*innen und Unterstützer*innen: redaktion@johannstadt.de
Noch mehr Festwochenende: Stadtreinigung lädt am 2. September zum Tag der offenen Tür
Die Johannstadt ist am kommenden Wochenende eine einzige Partymeile. Auch die Stadtreinigung haben allen Grund zu feiern und öffnen (endlich) wieder ihre Hoftore für große und kleine Besucher. Noch mehr Festwochenende: Stadtreinigung lädt am 2. September zum Tag der offenen Tür weiterlesen
Utopolis-Abschluss: Utopie-Karawane zieht durch die Johannstadt
Am Freitag, den 01.09. findet die Abschlussveranstaltung des vom Bund geförderten Programms „UTOPOLIS – Soziokultur im Quartier“ am Johannstädter Kulturtreff statt: Der PLATTENWECHSEL zieht mit Utopie-Karawane durch den Stadtteil und präsentiert abschließend viele seiner unwiederbringlichen Momente in einer künstlerisch kuratierten Ausstellung. Utopolis-Abschluss: Utopie-Karawane zieht durch die Johannstadt weiterlesen
Frauenkirche Dresden ruft zur Kundgebung am Fr., 25.8. 19 Uhr auf – »Alle zusammen für Glaubensfreiheit und gegen Islamfeindlichkeit«
Anlässlich einer Demonstation der “Freien Sachsen” durch Dresden gegen den Bau einer Moschee für das Marwa Elsherbiny Kultur- und Bildungszentrum (MEKZ) auf der Marschnerstraße in der Johannstadt ruft die Frauenkirche Dresden zur Kundgebung »Alle zusammen für Glaubensfreiheit und gegen Islamfeindlichkeit« am Freitag, 25. August 2023, 19 Uhr auf dem Neumarkt auf.
Dresdner Nachtlauf sorgt am 18.8. ab 17:30 Uhr für Verkehrseinschränkungen in der Johannstadt
Am Freitag, 18. August 2023, findet der 14. Dresdner Nachtlauf statt. Die Jüngsten ab drei Jahren starten bereits 19 Uhr zum Bambini-Lauf. Ab 19.15 Uhr beginnt der 1,2 Kilometer-Kinderlauf. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 11,5 Kilometer-Strecke geht es um 20 Uhr an den Start. Der 6,2 Kilometer-Lauf beginnt um 22 Uhr. Dresdner Nachtlauf sorgt am 18.8. ab 17:30 Uhr für Verkehrseinschränkungen in der Johannstadt weiterlesen
Bildungspaket unterstützt einkommensschwache Familien beim Schulstart – Schüler erhalten 116 Euro für Schulartikel
Neue Hefte, Blöcke, Stifte, Sportsachen, Bildungsticket, Kennenlernfahrt… Das neue Schuljahr beginnt für die insgesamt rund 60.000 Dresdner Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern mit vielen Ausgaben. Bildungspaket unterstützt einkommensschwache Familien beim Schulstart – Schüler erhalten 116 Euro für Schulartikel weiterlesen
Mit Künstlicher Intelligenz den Krankheitsverlauf bei Magersucht vorhersagen – Forscherteam am Uniklinikum weist strukturelle Gehirnveränderungen bei Betroffenen nach
Schultüte mit weniger Zucker
Für die zukünftigen Erstklässler ist die Schuleinführung ein sehr wichtiger Tag, bevor es am Montag, 21. August richtig los geht. Natürlich darf neben dem Schulranzen auch die Zuckertüte nicht fehlen. Eltern, Großeltern und Tanten möchten ihren Schulanfänger mit der kreativsten Tüte überraschen und füllen Sie liebevoll mit Bergen von Leckereien. Schultüte mit weniger Zucker weiterlesen
Abstellmöglichkeiten fürs Rad: So kann ein Fahrradbügel beantragt werden
Nicht nur Autofahrer kennen das Problem, für das eigene Fahrzeug einen Stellplatz zu finden. Auch Radler, die ihren Drahtesel sicher abstellen und am besten noch irgendwo anschließen wollen, können davon ein Lied singen. Fahrradbügel können hier Abhilfe schaffen. Abstellmöglichkeiten fürs Rad: So kann ein Fahrradbügel beantragt werden weiterlesen
Arbeiten an der Radroute Dresden Ost gehen weiter
Von Montag, 24. Juli 2023, bis voraussichtlich Mitte Dezember 2023 lässt das Straßen- und Tiefbauamt den westlichen Abschnitt der Radroute Ost zwischen Straßburger Platz und Henzestraße bauen.
Im Wesentlichen geht es um bauliche Veränderungen an den Kreuzungen der Comeniusstraße:
- Umbau der Kreuzung Comeniusstraße/Wintergartenstraße mit Deckentausch in Asphalt inklusive Herstellung barrierefreier Gehwegvorstreckungen und Anpassung der Straßenentwässerung.
- Umbau der Einmündungen Comeniusstraße/Schumannstraße, Comeniusstraße/Hähnelstraße und Comeniusstraße/Reißigerstraße mit barrierefreien Gehwegvorstreckungen für bessere Sichtverhältnisse und mehr Übersichtlichkeit beim Queren der Kreuzung für alle Verkehrsteilnehmer.
- Umbau der Hähnelstraße zwischen Comeniusstraße und Bertheltstraße für beidseitiges Querparken (analog dem 2022 gebauten Abschnitt zwischen Bertheltstraße und Wallotstraße). Fachleute erneuern dabei auch einige unterirdischen Medienleitungen und Anlagen (Trinkwasser, Strom, Straßenentwässerung, Internet).
Im August 2023 beginnen die Arbeiten zur Anbindung der Radroute Dresden Ost an den Straßburger Platz. Radfahrende in Richtung Innenstadt werden dann nicht mehr über die Wintergartenstraße zur Stübelallee geleitet, sondern über einen Geh- und Radweg ab der Kreuzung Comeniusstraße/Canalettostraße links abbiegend über die Freifläche neben dem SP1 in Richtung Straßburger Platz. Um das Queren der Fetscherstraße an der Kreuzung mit der Comeniusstraße für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern, wird im Herbst 2023 eine Ampel installiert. Der gesamte Streckenzug Comeniusstraße zwischen der Henzestraße und der Canalettostraße wird parallel zu den benannten baulichen Maßnahmen als Fahrradstraße markiert und beschildert. Dies bedingt Änderungen im Parkraum.
Anstehende Verkehrseinschränkungen
Ab Montag, 24. Juli 2023, bis voraussichtlich Ende September 2023 ist die Hähnelstraße halbseitig gesperrt, ebenso wie die Einmündung von der Comeniusstraße zur Schumannstraße. Nach dem Ende der Gleisarbeiten am Straßburger Platz ab Montag, 31. Juli 2023, bis Anfang Oktober ist die Kreuzung Comeniusstraße/Wintergartenstraße nur noch in Richtung des Krankenhaus St. Joseph-Stift als Einbahnstraße befahrbar.

Nach Fertigstellung der Einmündung Comeniusstraße/Schumannstraße beginnt der Bau der Einmündung Comeniusstraße/Reißigerstraße voraussichtlich im September 2023. Nach Fertigstellung der Kreuzung Comeniusstraße/Wintergartenstraße folgt die Einmündung Comeniusstraße/Hähnelstraße voraussichtlich im November 2023. Die fußläufige Erreichbarkeit der Grundstücke ist durchgehend gesichert. Zufahrten zu den Grundstücken sind nicht vorhanden.
Weitere Informationen zu späteren Verkehrseinschränkungen folgen zum entsprechenden Zeitpunkt.
Die Gesamtkosten für den westlichen Teil der Radroute Ost betragen rund 1,2 Millionen Euro. Die Bauarbeiten laufen in Zusammenarbeit mit der SachsenEnergie, Pyur und der Stadtentwässerung Dresden, die rund 135.000 Euro tragen. Die Radroute Dresden Ost dient der Verbesserung im Alltagsradverkehr und wird vom Freistaat Sachsen mit 635.000 Euro gefördert. Der Anteil der Landeshauptstadt Dresden beläuft sich auf rund 462.000 Euro.
Mehr Informationen zur Radroute Dresden Ost und Fahrradstraßen unter www.dresden.de/radroute-dd-ost
Quelle: Pressemitteilung der Landeshauptstadt Dresden
In eigener Sache: Dieser Artikel wurde verfasst/redaktionell bearbeitet durch die ehrenamtliche Stadtteilredaktion von johannstadt.de & die ZEILE. Sie haben auch Lust über die Johannstadt zu schreiben, Beiträge zu lektorieren oder die Redaktion organisatorisch zu unterstützen? Dann melden Sie sich unter redaktion@johannstadt.de.
Unterstützen können Sie unsere Arbeit auch mit Ihrer Spende!
IBAN: DE65 4306 0967 1215 9641 00, GLS-Bank Bochum oder über johannstadt.de.
Stadtteilmagazin ZEILE ist in der Sommerpause
Die sechste Ausgabe der ZEILE ist mittlerweile in einer ersten Runde verteilt. Wie es bei der Anlieferung der gedruckten Ausgabe zuging, zeigt das Bild oben. Erste Rückmeldungen sind bei der Redaktion eingegangen. Gern mehr davon!
Das erste Glas Stadtteilhonig – als Prämie für die Lösung des Kreuzworträtsels ist auch bereits vergeben.
Unser Büro im Johannstädter Kulturtreff e.V. Elisenstr. 35 macht Sommerpause: Ab 24. August ist es wieder regelmäßig donnerstags von 15 bis 17 Uhr für alle Interessenten geöffnet.
An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die Möglichkeit alle bisherigen Ausgaben der ZEILE auch online zu lesen.
Save-the-date! Festwoche 25.8. – 3.9.: Oberschule, Gymnasium, Lili-Elbe-Straße und Utopolis feiern
Auch wenn die Sommerferien noch im vollen Gange sind, schon mal an den Spätsommer denken: Save-the-date für: Plattengeburtstag – 50 Jahre Schulgebäude der 101. Oberschule, Gymnasium Dresden Johannstadt Eröffnung 2.0, Sommerfest Lili-Elbe-Straße und Utopolis-Abschluss. Save-the-date! Festwoche 25.8. – 3.9.: Oberschule, Gymnasium, Lili-Elbe-Straße und Utopolis feiern weiterlesen