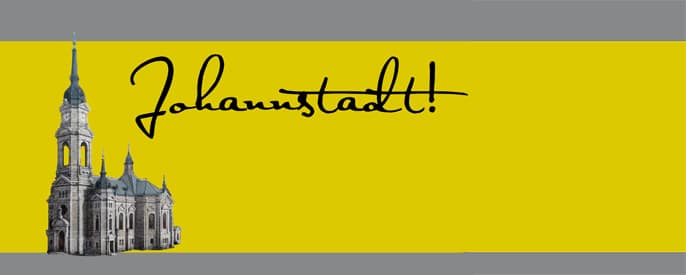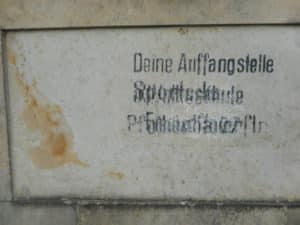Diese Seite ist mehrsprachig verfügbar: English, Русский, عربي.
Der Arnoldstraße in Richtung Elbe folgend, erreichen Sie den Thomas-Müntzer-Platz – Standort 6 des historischen Rundwegs.
Vor 1945: Feldherren, Flussbaden und Flieger

Feldherrenplatz
Der heutige Thomas-Müntzer-Platz entstand 1904 unter dem Namen Feldherrenplatz. Seine Namensgebung geht auf die angrenzende Feldherrenstraße (heute Florian-Geyer-Straße) zurück. Möglicherweise hat die Bezeichnung ihren Ursprung in der Ernennung des Kronprinzen und späteren Königs Albert 1871 zum Generalfeldmarschall. Bis etwa 1912 blieb der Platz unbebaut. Nach 1912 entstanden in kurzem zeitlichen Abstand die Gebäude mit den Hausnummern 3, 4 und 5. Der Striesener Tischlermeister und Inhaber eines Baugeschäftes Max Albin Förster errichtete diese. Drei Jahre später folgten die Häuser Nr. 6 und 7 von Landmesser Hans Gentsch und Bauunternehmer Friedrich E. Hermann. Im Haus Nr. 1 befand sich seit 1915 das Büro des XXV. Polizeireviers. Die neuen Häuser bewohnten vor allem wohlhabende Dresdner, darunter Hofschauspieler, Kunsthändler, Ingenieure, ein Bankprokurist, ein Fabrikbesitzer und ein Stadtbauinspektor.
Antons Bäder
Antons Bäder an der Elbe in unmittelbarer Nähe zum heutigen Fährgarten entwickelten sich zu einem beliebten Ausflugsziel der Johannstädter. 1754 erwarb der kurfürstliche Oberfloßinspektor Christian Gottlob Anton das Grundstück, auf dem zuvor ein Kalkofen stand. Er bekam die Erlaubnis, ein Haus mit Garten zu erbauen und eine Gastwirtschaft mit Brennerei, eigener Bäckerei und Schlachterei zu betreiben. Sein Bauwerk lehnte sich an das Vorbild französischer Landhäuser des Rokoko an. 1922 entstand auf dem Grundstück, mittlerweile im Eigentum der Stadt Dresden, ein Licht- und Luftbad. Die Bomben beim Angriff auf Dresden 1945 zerstörten Antons Bäder. Nur noch eine aufgewachsene Hecke an der Elbe kennzeichnet den Standort der ehemaligen Badeanstalt.
Weitere Informationen zur Geschichte von Antons Bädern finden Sie hier.
|
|
|
Der Wasserflugplatz Dresden
Im Jahr 1925 gab es in Dresden eine europäische Premiere: die Einrichtung einer Wasserfluglinie entlang der Elbe zwischen Dresden-Johannstadt und Altona bei Hamburg mit Zwischenlandung in Magdeburg durch die Junkers Luftverkehr AG. Diese verpflichtete sich zunächst für die Dauer von drei Monaten einen regelmäßigen Luftverkehr auf der Elbe mit Wasserflugzeugen des Typs Junkers F13 durchzuführen. Zur Flugabfertigung diente das noch vorhandene Gebäude der Rudergesellschaft, in dem sich heute das Restaurant “Johann” befindet. Unter regem Interesse der Bevölkerung erfolgte am 10. August 1925 der erste Start eines Flugzeuges vom Johannstädter Ufer in Höhe der damaligen Gneisenaustraße (heutige Bundschuhstraße). Bereits ein Jahr später erwies sich die Wasserfluglinie als unrentabel, im Herbst 1926 folgte die Einstellung.
Weitere Informationen zur Geschichte des Wasserflugplatzes finden Sie hier.
Nach 1945: Fährgarten und Festspiele

Aus dem Feldherrenplatz wird der Thomas-Müntzer-Platz
Anders als weite Teile der Umgebung überstand der Feldherrenplatz die Luftangriffe im Februar 1945 ohne große Verluste an Gebäuden. Ab 1945 führte ein Gleis der Trümmerbahn über den Platz. Dieses fand bis etwa Mitte der 1950er Jahre Verwendung, um die Trümmer der zerstörten Johannstadt an die Elbwiesen zu bringen. Ab 1946 erhielten zahlreiche Straßen der nördlichen Johannstadt neue Namen mit Bezug zum Bauernkrieg, zum Beispiel Bundschuhstraße, Pfeifferhannsstraße und Florian-Geyer-Straße. Der Feldherrenplatz bekam in diesem Zusammenhang den Namen des Bauernkriegsführers Thomas Müntzer.
Elbwiesen nach 1945
Nach Kriegsende verfüllte man die Johannstädter Elbwiesen zwischen Neubertstraße und Schubertstraße mit Trümmern. Die Wiesen wurden so deutlich erhöht. Eine Sammlung der Trümmer, die beim Bau des Parkplatzes an der Waldschlößchenbrücke im Jahr 2007 ans Licht kamen, waren bis 2023 in der Ausstellung Wohnkultur in der JohannStadthalle zu sehen. Das Gelände von Antons Bädern diente nach Abbruch der Gebäude im Jahr 1958 zunächst als Kleingartenanlage Elbfrieden II. Pläne zur Errichtung eines internationalen Campingplatzes in den 1970er Jahren fanden keine Umsetzung, weil die Fläche im Hochwassergebiet liegt. Die Elbwiesen sind heute ein beliebtes Naherholungsgebiet und Veranstaltungsgelände.
Johannstädter Festspiele und Elbefest
Die Johannstädter Festspiele auf den Elbwiesen fanden erstmals 1972 auf Initiative des Stadtbezirks Dresden-Mitte statt. Die dreitägige Veranstaltung war als Volksfest konzipiert und bot Unterhaltung für Jung und Alt, so 1975 ein Konzert mit Nina Hagen. Im Jahr 1983 kamen 70.000 Gäste, die 7.000 Liter Bier tranken und 12.600 Fischsemmeln am „Dampferstand“ der Konsum-Handelsgesellschaft verzehrten. Bis zum Ende der DDR fanden 14 Johannstädter Festspiele statt, letztmalig vom 8. bis 10. September 1989. 2001 wurde die Tradition durch die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt eG (WGJ) mit dem jährlich stattfindenden Johannstädter Elbefest wiederbelebt.
Mehr Informationen zu den Johannstädter Festspielen finden sie hier.

|
|
|
Johannstädter Elbeschwimmen
Fast 100 Freiwillige folgten am 15. August 1998 dem Aufruf des damaligen Ortsamtsleiters Dr. Dietrich Ewers (1939-2018) und stiegen am Blauen Wunder ins noch nicht ganz saubere Elbwasser (Güteklasse 2) zum ersten Johannstädter Elbeschwimmen. Drei Kilometer weiter flussabwärts lockten am Fährgarten Johannstadt ein Freigetränk und eine Bratwurst. Am 20. Elbeschwimmen 2018 beteiligten sich bereits 1.789 Menschen – ein neuer Rekord. Bis 2016 leitete Dr. Dietrich Ewers das Elbeschwimmen. Der gebürtige Magdeburger lebte seit 1965 am Thomas-Müntzer-Platz und war ein Johannstädter Original. Mit der Wende wechselte der Ingenieur in die Politik, wurde Stadtrat und übernahm 1990 für 14 Jahre die Leitung des Ortsamtes Altstadt. Neben dem Elbeschwimmen gehen auch die Gründung des Dresden Marathon e.V. und die Einrichtung der Vietnamesischen Gärten in der Johannstadt auf sein Engagement zurück.
Weitere Informationen zum Johannstädter Elbeschwimmen finden Sie hier.

Text: Matthias Erfurth, Matthias Kunert, Henning Seidler
Redaktionsschluss: Januar 2024